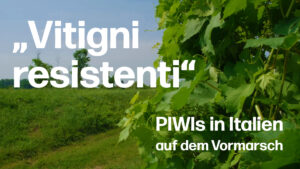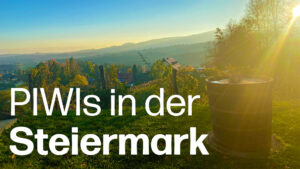Wie lassen sich neue Rebsorten finden, die widerstandsfähig, geschmacklich überzeugend und gleichzeitig umweltschonend sind? Eine Antwort darauf gibt der Delinat-Winzer Roland Lenz aus dem Kanton Thurgau. In seinem Versuchsgarten zeigt er, wie er die PIWI-Super-Rebe zu finden gedenkt.
Blogartikel von Olivier Geissbühler
Neue Reben für neue Klimabedingungen
Frühlingszeit ist im Weinberg auch immer Rebenpflanzungszeit. So auch auf dem Delinat-Weingut Lenz: Beim Besuch ist Roland Lenz mit seinem Team gerade daran, im Muttergarten neue Sorten anzupflanzen. Zuvor wurden fast alle alten Reben dort ausgerissen, weil sie nicht zu 100 Prozent überzeugt hatten. Nur elf Sorten waren über mehrere Jahre hinweg komplett krankheitsresistent und wiesen auch sonst alle Eigenschaften auf, die sich eine Winzerin oder ein Winzer bei einer neuen Rebsorte wünscht.
Roland Lenz betreibt seinen Versuchsgarten, um neue, robuste Rebsorten unter realen Bedingungen zu testen, bevor er sie in grösseren Mengen anpflanzt. In diesem geschützten Rahmen kann er hundertfach verschiedene Züchtungen beobachten, ihre Widerstandskraft gegen Krankheiten wie Mehltau prüfen, ihr Wachstum bewerten und die Traubenqualität beurteilen. So stellt er sicher, dass nur die besten Sorten – also jene, die sowohl ökologisch als auch geschmacklich überzeugen – in grösserem Umfang kultiviert werden.
Was genau ist ein «Muttergarten»?
Ein Muttergarten ist ein speziell angelegter Weinberg oder Pflanzbereich. Dort wachsen ausgewählte Rebsorten – sogenannte Mutterreben – die zur Vermehrung neuer Reben dienen. Diese Reben liefern das Vermehrungsholz (also Rebholz für Stecklinge), aus dem genetisch identische Nachkommen entstehen. Im Fall von Roland Lenz enthält der Muttergarten die vielversprechendsten Züchtungen, die er weiter beobachten und vermehren will. Der Muttergarten ist somit das „Gen-Reservoir“ und die Grundlage für die nächste Rebengeneration – ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Einführung neuer Sorten im Weinbau.
Wie entsteht eine neue Rebsorte?
Am Anfang steht die Kreuzung: Zwei Rebsorten – zum Beispiel eine besonders resistente mit einer geschmacklich hochwertigen – werden miteinander gekreuzt. Aus den daraus entstandenen Kernen wachsen Sämlinge, die zunächst ohne Reblaus-resistente Unterlage gepflanzt werden müssen. Daher stehen sie in einem speziellen Versuchsgarten ausserhalb der klassischen Rebbauzonen.
In diesem Muttergarten wachsen hunderte verschiedene Jungpflanzen – jede ein genetisches Unikat. Doch nur die allerbesten schaffen es weiter. Roland Lenz spricht von 450 Sorten, von denen über die Jahre nur elf übrig geblieben sind.
Selektion der «PIWI-Super-Reben»
Getestet wird auf alles, was für den Weinbau wichtig ist: Krankheitsresistenz, Traubenqualität, Wuchsverhalten, Blätterdichte – und natürlich, ob die Sorte den immer extremeren Wetterbedingungen standhält. Dabei halfen die letzten Jahre mit extrem feuchten und trockenen Phasen bei der natürlichen Selektion.
Pflanzen, die den Pilzkrankheiten Echter und Falscher Mehltau nicht standhalten, werden rigoros entfernt. Ebenso jene, deren Trauben qualitativ enttäuschen oder deren Laub zu dicht wächst – denn das erhöht die Krankheitsanfälligkeit. Roland Lenz betont, dass diese Selektion gnadenlos ist – doch sie ist notwendig, um langfristig robuste und qualitativ überzeugende Reben zu etablieren.
Ein Fundament für den Weinbau von morgen
Die elf vielversprechendsten Sorten werden nun vegetativ vermehrt – das heisst: Aus geschnittenem Holz entstehen genetisch identische Nachkommen. Pro Sorte werden rund 200 Reben gezogen, die Roland Lenz im kommenden Jahr in die für die Weinherstellung gedachten Weingärten pflanzt. Erst in einigen Jahren wird sich zeigen, ob sie sich dort bewähren. Der ursprüngliche Versuchsgarten bleibt in der Zwischenzeit als Absicherung bestehen.
Die Arbeit von Roland Lenz ist ein Paradebeispiel dafür, wie sorgfältige Selektion, langjährige Beobachtung und der Wille zur Innovation den Weinbau zukunftsfähig machen. Ohne Pestizide, ohne Kompromisse bei der Qualität – dafür mit viel Geduld, Wissen und Pioniergeist. Diese Arbeit ist der Grundstein für die Zukunft des Weinbaus.